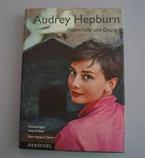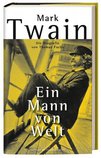Biografieempfehlungen aus dem Jahr 2014
Die Biografieempfehlung des Monats Januar 2014
Richard Burton: Die Tagebücher. Haffmans & Tolkemitt
Endlich auch hierzulande zu erwerben: "Brillant Gossip", bejubelte ein TV-Kulturmagazin das Erscheinen der 684 Seiten starken deutschen Übersetzung. Aber Richard Burtons Tagebücher sind mehr als das. Die Aufzeichnungen des britischen Shakespeare-Mimen, der seinen Aufstieg aus dem walisischen Bergarbeitermilieu zu einem der bedeutsamsten Theater- und später berühmtesten Filmschauspieler mit Unterstützung seines Mentors Philip Burton bewerkstelligte, dessen Nachnamen er zu seinem machte, behandeln vor allem die Zeit von 1966 bis 72. Es sind die Jahre seiner Ehe mit Elizabeth Taylor und der glamourösen Inszenierungen vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Es sind ebenso die Jahre der Zerwürfnisse, der Alkoholexzesse und des Bur(to)n-out. Wer Details aus dem Innenleben einer turbulenten Liebesbeziehung erwartet, wird keineswegs enttäuscht. Burton erweist sich zudem als ein akribischer Arbeiter, äußerst belesener Chronist, unglaublich witziger Beobachter und stilsicherer Causeur. Allein die Schilderung seiner Begegnungen mit Jugoslawiens Staatschef Marschall Tito, dessen Lebensrolle er in einer Verfilmung übernahm, lohnten die Lektüre dieses Buchs. Ungezählte Begegnungen mit und Kommentare zu auch heute nicht vergessenen Personen jener Zeit sind vergnüglich zu lesen. Zu seinen Lieblingshaudraufs zählt Frank Sinatra und auch einem stillen Verehrer von Hardy Krüger sei die Lektüre der Burton-Tagebücher nicht unbedingt ans Herz gelegt.
Ansonsten unbedingt empfohlen von Alfons Huckebrink
Die Biografieempfehlung des Monats Februar 2014
Daniil Granin: Rede zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus vor dem Deutschen Bundestag
Am 27. Januar 2014 hielt der 1919 geborene Schriftsteller Daniil Granin eine Rede im Deutschen Bundestag. An diesem Tag, der an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee 1944 erinnert, endete vor siebzig Jahren nach fast 900 Tagen Dauer auch die Belagerung Leningrads durch die deutsche Wehrmacht. Die Blockade dieser Stadt kostete um die 1 Million Menschen das Leben, die meisten von ihnen sind verhungert. "Ihr Tod", erinnerte Bundestagspräsident Norbert Lammert, "war von den Verantwortlichen des deutschen Vernichtungskriegs im Osten einkalkuliert. Leningrad sollte nicht erobert, sondern als Wiege des sogenannten 'jüdischen Bolschewismus' vernichtet werden." In seiner erschütternden Rede beschreibt der 95-jährige Schriftsteller Granin, der die Blockade als Soldat miterlebte, den Terror und die unermesslichen Leiden der Bevölkerung.
Wir machen den Text den Besuchern unserer Biografieempfehlungen als Datei zugänglich und empfehlen ihn nicht nur als Lektüre, sondern auch zur Weiterverbreitung und fortdauernden Erinnerung.
Alfons Huckebrink
PDF-Dokument [83.9 KB]
Die Biografieempfehlung des Monats März 2014
Kerstin Decker: Lou Andreas-Salomé. Der bittersüße Funke Ich.
2010 Ullstein - Verlag. Büchergilde Gutenberg.
Kerstin Decker zeichnet das einfühlsame Portrait einer ungewöhnlichen Frau des ausgehenden 19.Jahrhunderts. Lou Salomé wurde in St. Petersburg geboren und wuchs mit Ihrer Familie in der Nachbarschaft zur Zarenfamilie auf. Sie war der Liebling ihres Vaters, eines deutschen Generals, der relativ früh verstarb, und ihrer Brüder. Als Kind wurden ihr viele Freiheiten gestattet. So ließ sich sich von einem Priester konfirmieren, der einer anderen Kirche angehörte als ihr Vater, der selbst Kirchengründer war. Dieser Lehrer führte sie in die Welt der Philosphie ein, z.B. in ein vertieftes Kant-Studium, und verliebte sich schließlich in sie. Als er ihr einen Heiratsantrag machte, beendete sie unverzüglich die Beziehung. Diese ihr selbstverständliche Zuneigung von Männern begleitete sie ein Leben lang, wobei sie sich niemals gebunden zu fühlen schien. Ihr Bildungshunger und ihre Bildung sowie ihre selbstverständliche Selbstbestimmtheit machten sie zu einer außergewöhnlichen Frau in einer Zeit, in der das Frauenbild ein ganz anderes war. Sie studierte in Zürich, der einzigen Universität, an der Frauen studieren durften. Sie reiste und lebte mit zwei Männern, die sie beide verehrten, in einer platonischen Wohngemeinschaft zusammen. Einer ihrer Verehrer war Nietzsche, der andere Ré, beide konnten ihr keine Heiratszusage abringen. Erst ein Herr namens Andreas konnte sie nach einem Selbstmordversuch zur Verlobung und späteren Heirat überzeugen. Die Ehe blieb jedoch auf Wunsch von Lou Andreas-Salomé asexuell und wurde auf dem Versprechen gegründet, nie das Bett miteinander teilen zu müssen. Erst im Alter von 36 Jahren gab sie ihr asexuelles Leben auf, zugunsten des 15 Jahre jüngeren Rilke. Zwar war sie seine Muse, aber seine Gedichte verstand und schätzte sie nicht.
Die hohe und ungewöhnliche Bildung und Selbstbestimmtheit einerseits und die Zurückhaltung im Beziehungsbereich andererseits können, müssen aber nicht als widersprüchlich erlebt werden. Ob die
Zurückhaltung auf Angst vor Nähe und den Verlust von Selbstständigkeit zurückgeht oder den innersten Bedürfnissen nach einem eher geistigen Leben und intellektuellen Schaffen folgt, lässt Kerstin
Decker offen. Sie bewertet nicht, sondern beschreibt eine ungewöhnliche Frau, einen ungewöhnlichen Menschen, der durch seine - sie nennt es - "Ichbezogenheit" oder aus der Sicht der Zeitgenossen
durch "unangemessenes Vertrauen zum eigenen Ich" verwundert. Dabei legt die Biografin interessanterweise und möglicherweise im Gegensatz zu Lou A.-S. den Schwerpunkt auf die Beziehungen und weniger
auf das Schaffen von Lou A.-S. Dabei werden die Biografien der Bezugspersonen, Freunde und Lebensgefährten ebenso gründlich recherchiert wie einfühlsam beschrieben. Empfohlen von Gudula
Ritz-Schulte.
Die Biografieempfehlung des Monats April 2014
Jochen Schimmang: Christian Morgenstern. Eine Biografie. Residenz Verlag 2013
"Die Möwen sehen alle aus, / als ob sie Emma hießen." Wer hätte sie nicht im Ohr, die Eingangsverse des berühmten Möwenlieds! Am 31. März 2014 jährte sich der Todestag des Dichters Christian Morgenstern zum 100. Mal. Geboren im Jahr der Reichsgründung 1871, gestorben wenige Monate vor Beginn des ersten Weltkriegs, der dessen Untergang einleitete. Über das kurze Leben des Dichters, der zwischen 1895 und 1914 eine Reihe von Gedichtbänden publiziert hat, von denen vor allem die "Galgenlieder" enormen und anhaltenden Erfolg verzeichneten, ist dem Publikum relativ wenig bekannt geworden. Eine lesenswerte Abhilfe schafft da die rechtzeitig erschienene Biografie von Jochen Schimmang, die das ruhelose, von zahlreichen Ortswechseln geprägte Leben Morgensterns nachzeichnet. Neben seinem Werk geraten sowohl die Begeisterungsfähigkeit Morgensterns etwa für Nietzsche, später vor allem für Rudolf Steiner und dessen Lehre sowie die Beeinträchtigung durch die sich verschlimmernde TBC-Erkrankung ins Blickfeld. In 10 Exkursen beleuchtet Schimmang wichtige Begleitpersonen und bedeutsame Schauplätze dieses außergewöhnlichen Lebens. Er widmet sich zudem dem Nachleben des Werks und besteht auf dem einzigartigen Rang in der neueren Literaturgeschichte, der Morgenstern aufgrund seines subversiven Umgangs mit Sprache zukommt. "Es war einmal ein Lattenzaun, / mit Zwischenraum, hindurchzuschaun …", der Schöpfer solcher unvergänglichen Verse kann getrost Klassikerstatus beanspruchen. Was Morgenstern durchaus im Sinn gelegen hat.
Empfohlen von Alfons Huckebrink
Die Biografieempfehlung des Monats Mai 2014
Sean Hepburn Ferrer: Audrey Hepburn - Melancholie und Grazie. Erinnerungen eines Sohnes. Berlin: Henschel, 2013, 8. Auflage.
Diese Biografie unterscheidet sich von den meisten anderen dadurch, dass ein naher Angehöriger, der trauernde Sohn, seine persönlichen Erinnerungen beschreibt. Dieser Unterschied erklärt die Besonderheiten dieser Biografie: Die Beschreibung erzeugt und beschreibt viel Nähe und eine differenzierte Positivität, die man auch als Idealisierung verstehen kann. Das Buch enthält über 300 Fotografien, Zeitzeugen von der Geburt AHs 1929 bis zum relativen frühen Tod 1993. Die dargestellten Fotografien haben neben ihrer Qualität als Zeitdokumente z.T. Seltenheitswert und sind darüber hinaus von hoher ästhetischer und künstlerischer Qualität und Ausdruckskraft. Den Sohn beschäftigt die traumatische Kindheit der Mutter als Kriegsflüchtling und Hunger Erleidende sowie die Auswirkungen auf seine eigene Kindheit. Die Kindheit der Mutter konstruiert er als Mangelerfahrung nicht nur in materieller, sondern auch in emotionaler Hinsicht, vor allem durch die Trennung der Familie vom Vater, der von AH als "emotionaler Invalide" wegen seiner Distanziertheit und der Unfähigkeit, positive Gefühle zu zeigen, beschrieben wird. Der Weg als Künstlerin wird bewundernd nachgezeichnet von der Fünfzehnjährigen, die sehr schöne Zeichungen anfertigt, bis zur weltbekannten Schauspielerin. In späteren Jahren bis kurz vor Ihrem Tod engagiert sich AH für UNICEF. AH wird als warmherzige, traurige, großzügige, einfühlsame und liebevolle Frau beschrieben, die die einfachen Dinge des Lebens schätzt, die Natur, das Haus am Genfer See, den Blumengarten, vor allem das Zusammensein mit der Familie. Empfohlen von Gudula Ritz-Schulte
Die Biografieempfehlung des Monats Juni 2014
Paul Nizon: Die Belagerung der Welt: Romanjahre. Berlin: Suhrkamp 2013
„ … in den eigenen Umriss steigen“ - Jene fünf Journalbände, von Nizon selbst einmal als Seitenflügel seines Werks apostrophiert, umfassen etwa 1400 Druckseiten und stellen ihrerseits eine Auswahl aus einem gut zehnmal so umfangreichen Ausgangsmaterial dar: Belege eines täglich organisierten und durchgehaltenen Schreibprozesses, im Ergebnis weit mehr als Fingerübungen eines Ich-Erzählers, sondern dessen lebenslange Selbstvergewisserung. „Weil ich eben davon ausgehe, dass ein nicht geschriebener ein verlorener Tag ist, weil ein grauer, ein nicht an mich gebrachter Tag“, gestand Nizon 2008 im Interview. Nach kritisch kreativer Sichtung durch den Herausgeber Martin Simmons nahm der Plan, das Material der fünf voluminösen Sammlungen wiederum in einem einzigen Band zu komprimieren, inzwischen Gestalt an und der dazu gefundene Titel „Die Belagerung der Welt“ widerlegt anfängliche Skepsis, unter welchem Gesichtspunkt das gewaltige Konvolut an (Selbst-) Beobachtungen, Zustandsberichten, Kollegenlob und -schelten durchforstet und neu komponiert werden könne. Ausgestellt werden hier nun die Gratwanderung um eine Existenz als Künstler, die verzehrende Sucht nach Anerkennung als Schriftsteller sowie das anhaltende Ringen um Welthaltigkeit des Werks. Die Zusammenstellung ermöglicht derart die konzise Betrachtung eines Künstlerlebens, das der Welt und ihrem Getriebe abgetrotzt wurde und wird.
Am Anfang jedoch steht ein Umriss. Der Umriss ist wüst und blutleer und verlangt nach Leben oder dem Leben abgetrotzter Kunst. Die eingangs zitierte Maxime findet sich in den 1970er Jahren, ein Zeitraum, in dem Nizon um einen künstlerischen Ausdruck ringt und sich der Diskrepanz zwischen hehrem Anspruch und nüchterner Analyse mehr trotzig als schmerzlich bewusst wird: „Ich möchte das Große, Einmalige, Tiefe, Unvergleichliche, Reine - des Dichters. Und ich möchte die (Mailersche) Öffentlichkeitswirkung des resonanzreichen Opponenten. Und habe weder das eine noch das andere. Nur die Zwiespältigkeit und innere Zerrissenheit und Schwereinschätzbarkeit und Isolation. Und allen zugehörigen Haß. Und alle zugehörige Wut und Überheblichkeit … Basta.“ Seit den Berner Anfängen strebt Nizon nach einem Rang als anerkannt großer, europäischer Schriftsteller, den er denken kann ausschließlich in seiner Existenzform als Künstler. Für diese anachronistisch anmutende Daseinsweise, in der Schreiben zur Lebenskunst wird und diese erst ermöglicht, riskiert er viel, fast alles. Die bewusst in Kauf genommenen Brüche im privaten Bereich („Bin ich eine Geißel der Frauen?“), die Abgeschiedenheit mitten in Paris, damit einhergehend die zeitweise lähmenden Depressionen. Nach der Trennung von seiner zweiten Frau Marianne, dem Exodus an die Seine und der unabgegoltenen Liebe zu Odile, seiner späteren Frau, treibt ihn eine erschreckende Ungeborgenheit in den gefährlichen Randbereich der Ich-Empfindung: „Und ich hatte wahrhaftig Angstzustände, Panik stieg in mir auf, ich hatte wahr und wirklich den Verdacht, daß etwas in meinem Kopf ausklinken könnte, ich war eingesperrt und ausgesperrt vom Leben, ich blieb fixiert auf diese eben noch niedergehaltene Idee des drohenden Ausklinkens, aufgespießt auf diesen Angstgedanken.“
Deutlich werden die Enttäuschung des Autofiktionärs über mangelnde Anerkennung nach dem „Canto“ (1963), das Glück des Gelingens nach „Das Jahr der Liebe“ (1981), die Genugtuung nach „Das Fell der Forelle“ (2005). So bleibt ihm die Belagerung der Welt lebenslange Disposition. Jene bleibt unergründlich, wird sich nie ergeben und der Künstler muss anrennen und ausharren vor ihren Zinnen. Das gleichnamige Buch indessen fügt sich ein und legt erstaunliches Zeugnis ab. Jedenfalls bietet es in nuce all das, was Nizon ausmacht: eine kophtische Fiktionalität, die Musikalität der Sprache, die Feier des Augenblicks, das allgegenwärtige Paris-Gefühl, nicht zuletzt der stets neu energetisierte Höhenflug des Lebens. Aus einem Umriss entsteht vor den Augen des Lesers im „Schönheitsflockengestöber“ das Werk. Absehbar wird der in Frankreich bereits ungemein populäre und gefeierte Schriftsteller auch in Deutschland seinen Rang unter den großen Sprachvirtuosen einnehmen. Als ein moderner Don Quijote, der den Traum des Künstlers ins 21. Jahrhundert hinübergerettet hat. Empfohlen von Alfons Huckebrink
Die Biografieempfehlung des Monats Juli 2014
Thomas Fuchs: Mark.Twain. Ein Mann von Welt. Berlin: zweitausendundeins-Verlag 2012
Diese Biografie schildert auf kleinstem Raum, und zwar auf 208 Seiten (obwohl Fuchs nach eigenen Angaben auch 2000 hätte schreiben können), auf fundierte Weise das Leben von Mark Twain in seinen kulturellen und historischen Bezügen. Mark Twain, das Pseudonym von Samuel Clemens, wuchs in Missouri unter ärmlichen Verhältnissen auf. Am Anfang des 19. Jahrhunderts war Missouri Grenzland, weiter im Westen warteten nur noch Indianer und weite Prärie. Als Lotse auf dem Mississippi bedeutete "Mark Twain" die Bezeichung für einen Wasserstand auf der Grenze vom tiefen zum untiefen Wasser. Das wechselhafte Leben als Reiseschriftsteller, Journalist, Verleger und Romanautor wird auf empathische, nie auf idealisierende Weise beschrieben. Aber auch das als erfüllter Familienmensch und liebender Ehemann. Twain schrieb nicht nur unermüdlich, mal mehr intrinsisch, mal mehr extrinsisch motiviert, er verfolgte auch geschickte und modern wirkende Marketingstrategien. Thomas Fuchs schreibt fast ebenso humorvoll über Twain, wie der selbst zu schreiben pflegte. Und er bezeichnet ironisch Twain als Rassisten, denn so viele weiße Betrüger und Schurken und edle Farbige auf einmal wie in dessen Prosa sind selten zu bestaunen. Die implizite emanzipatorische Botschaft in Twains Werken ermutigt zu einem unbeirrbaren Selbstsein. Empfohlen von Gudula Ritz-Schulte.
Die Biografieempfehlung des Monats August 2014
Diane Middlebrook: Du wolltest deine Sterne. Sylvia Plath und Ted Hughes. Hamburg: edition fünf 2013
Der Lyrik Sylvia Plaths begegnete ich wieder bei den "Danses Nocturnes" während der Ruhrfestspiele 2014, als sie in der Interpretation der Schauspielerin Charlotte Rampling und im suggestiven Dialog mit der Musik Benjamin Brittens die Zuhörer unwiderstehlich in ihren Bann zog. Hörbar, ja erlebbar wurde so an diesem Abend, was Plath als Impetus und Spannungsrahmen ihres lyrischen Schreibens in einem Interview mit der BBC im Jahre 1962 prägnant formulierte: "Meine Gedichte kommen direkt aus meinen sinnlichen und emotionalen Erfahrungen …" und "Ich glaube, dass man in der Lage sein sollte, Erfahrungen zu kontrollieren und zu beeinflussen, selbst die schrecklichsten wie den Wahnsinn, die Qual …".
Was also lag näher, als zum Buch der 2007 verstorbenen Diane Middlebrook zu greifen, Professorin für feministische Studien an der Stanford University, die sich in einer beeindruckenden, essayistisch angelegten Doppelbiografie vor allem den gemeinsamen Jahren von Sylvia Plath und ihrem Ehemann Ted Hughes widmet sowie des kurzen Zeitraums zwischen beider Trennung im Oktober 1962 und dem Suizid Plaths am 11. Februar 1963 in ihrer Londoner Wohnung, in der sie die Ritzen an Küchenfenster und Wohnungtür abdichtete und das Gas des Backofens aufdrehte.
Deutlich und mit großer Plausibilität schildert Middlebrook in ihrem Buch das Auseinanderleben der Eheleute und zeichnet überzeugend die auseinanderstrebenden Emazipationsrichtungen der beiden nach: Sylvia Plaths Abkehr von ihrer Rolle als treusorgender Ehefrau und Mutter und Ted Hughes' Loslösung von Robert Graves' Mythos der Weißen Göttin, die er in seiner Frau erblickte und der er im Ritual des Dichtens huldigte. Nach deren Tod indessen verwandelte er ihre Ehe in einen bleibenden Mythos.
Das Herausragende an Middlebrooks Methode besteht darin, dass sie die lyrischen Texte von Plath und Hughes in ihren biografischen Deutungshorizont einbringt und diese als verdichtetes Leben zu erklären vermag. Insbesondere die Sammlung "Birthday Letters" von Ted Hughes, von diesem als Chronik ihrer Beziehung nachträglich konzipiert und erst 1998 der Öffentlichkeit vorgelegt, wird hier aufschlussreich hinterfragt.
"Die Depression tötete Sylvia Plath" konstatiert Middlebrook und wendet sich damit gegen ein überkommenenes Täter-Opfer-Schema, das Hughes verantwortlich macht für den Selbstmord seiner Frau.
Endlich liegt diese lesenswerte Doppelbiografie auch in deutscher Sprache vor und wird unbedingt empfohlen von Alfons Huckebrink.
Die Biografieempfehlung des Monats September 2014
Meret Oppenheim: Träume Aufzeichnungen. Berlin: Suhrkamp, 2. Aufl., 2013
"Träume Aufzeichnungen" gehört zum schmalen literarischen Œvre der bildenden Künstlerin Meret Oppenheim (1913-1985). Sie hat über eine weite Spanne ihres Lebens ihre Träume notiert, neben einer überschaubaren Anzahl von Gedichten. Diese Aufzeichnungen sind Narrationen ihrer Traumerinnerungen sowie Notizen über Assoziationen und Reflexionen dazu, wobei sie sich beim Schreiben offenbar auf das Wesentliche beschränkt hat (79 S.). Diese Traumnotizen stellen sowohl einen biografischen Fundus als auch einen Zugang zu ihrem künstlerischen Schaffen dar, was unterstrichen dadurch wird, dass während einer über zehnjährigen Schaffenskrise (1945-1954), wie die Künstlerin selbst retrospektiv bemerkt, keine Träume notiert werden. M.O. beginnt mit ihren Traumnotizen im Alter von 14 Jahren, zunächst in Notizheften mit blauer Tinte, später auf ganz unterschiedlichem Papier, manchmal auf Zetteln oder Rückseiten von Briefumschlägen. Die Herausgeberin Christiane Meyer-Thoss, der M.E. kurz vor ihrem Tod die Traumnotizen als Konvolut z.T. loser Blätter überreicht, erkennt somit das Traumtagebuch als künstlerisches Arbeitsbuch, als Logbuch und Spiegel ihrer ästhetischen Inspiration. Somit bildet das literarische Werk einen wichtigen Schlüssel und Zugang zur ästhetischen Haltung und Arbeitsweise dieser Künstlerin. Sie sind von einer besonderen sprachlichen Nüchternheit gekennzeichnet, fast lakonisch und unterkühlt beiläufig erzählt. Die Narrationen selbst besitzen Merkmale und Qualität von Träumen: Sie sind scheinbar fragmentarisch, der Zusammenhang erschließt sich in der Subjektivität der Persönlichkeit der Träumenden, sind Erweiterung des Möglichkeitsraums jenseits biografischer Festschreibungen und unabhängig von Logik, ungewöhnliche (und somit manchmal innovative) Assoziationen, Selbstausdruck u.v.a.m. In den Beschreibungen der Bilderwelten ihrer Träume hebt M.O. das Nichtintentionale, Absichtslose hervor und nutzt ihre Bezug nehmenden Notizen zur kontinuierlichen Standortbestimmung und in die Zukunft erweiterten Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie. Dabei versteht sie Kunst als etwas Universales und sich selbst als Teil von etwas Größerem, analog zu C.G. Jung`s Ansatz der Psychologie, den sie persönlich kannte. Wenngleich vieles beiläufig und zufällig erscheint, weist es auf eine hohe intuitive Intelligenz hin, auf etwas Ahnungsvolles, denn in manchen Träumen nimmt sie, wenn auch logigsch nicht und nur retrospektiv erkennbar, ihre eigene Zukunft und die der damaligen Gesellschaft vorweg: "Dez. 1954 - Ich sitze an langem Tisch mit meinen Pariser Freunden, von denen aber niemand deutlich ist ausser Breton und Péret. Der Tisch steht in einer weiten Landschaft, auf einer erhöhten Ebene, man sieht in der Ferne am Horizont Bergketten. - Am Himmel, gegen Süden, werden plötzlich Flecken sichtbar, ähnlich den Klecksen auf den Rorschach-Testbildern. Diese Flecken verwandeln sich in die Silhouette eines umgestürzten Eisenbahnwagens. Alles schaut fasziniert an den Himmel." Die jetzt beschriebene Vision bezieht sich auf den Krieg. "Dann erscheint im Westen ein Löwe. Ockergelb, ein stilisierter, heraldischer Löwe. [....]. Wir <wissen alle was diese Vision bedeutet>. -[...] (In Wirklichkeit weiss ich nicht, was der Traum bedeutet.)." S.35.
Empfohlen von Gudula Ritz-Schulte
Die Biografieempfehlung des Monats Oktober 2014
Lidia Ginsburg, Aufzeichnungen eines Blockademenschen. Suhrkamp, 1. Aufl. 2014
Noch einmal die Blockade von Leningrad als Lebensthema (siehe auch die Rede von Daniil Granin im Deutschen Bundestag in unserer Empfehlung vom Februar).
Unter einer Dystrophie – von altgr. dys „schlecht“ (hier „Fehl-“) und trophein („ernähren“, „wachsen“; „Fehlernährung“, „Fehlwachstum“) – werden in der Medizin degenerative Besonderheiten verstanden, bei denen es durch Entwicklungsstörungen einzelner Gewebe, Zellen, Körperteile, Organe oder auch des gesamten Organismus zu entsprechenden Degenerationen (Fehlwüchsen) kommt.
Die Blockade Leningrads dauerte vom 8.09.41 bis zum 27.01.44. Heutige Schätzungen sprechen von 700000 bis über 1 Million Toten unter der Zivilbevölkerung, die meisten von ihnen verhungert (Dystrophie). Dieser massenhafte Hungertod wurde von der deutschen Wehrmacht systematisch herbeigeführt, die Methode ihrer Kriegsführung zielte nicht auf Eroberung, sondern auf Aushungerung ihrer Bewohner.
Lidia Ginsburg (geb. 1902 in Odessa, gest. 1990 in Moskau) erlebte die Blockade am eigenen Leib. Sie wurde zum wichtigsten Thema ihrer schriftstellerischen Arbeit. Das hier erstmals zu einem Buch zusammengestellte Textkonvolut aus Erzählungen, Reflexionen und Tagebuchnotizen entstand über einen langen Zeitraum. Ginsburg zeigt auf, wie unter den Bedingungen von Hunger, Krankheit und Überlebenskampf ein besonderer Typus Mensch entstand, der zeitlebens von dieser grauenvollen Erfahrung geprägt blieb. Insbesondere der das Buch einleitende Text "Eine Erzählung von Mitleid und Grausamkeit", in dem Otro, der Protagonist, nach dem Tod seiner Tante in einem Wirbel von Schuldgefühlen und Reue verschwindet, trägt autobiografische Züge. Ginsburg thematisiert ihre eigenen widersprüchlichen Empfindungen und Vorwürfe nach dem Tod ihrer Mutter Ende 1942.
Die Autorin stellt sich den großen Fragen und ringt um allgemeineingültige Erkenntnisse. Ein ernstes Buch um die Grenzbereiche der Menschlichkeit ruft beim Leser nichts weniger als ehrfürchtiges Staunen und Dankbarkeit hervor. Ginsburg geht es nicht in erster Linie um das Sterben und den Tod, sondern um die Bewährung in solchen Siuationen, also letztendlich um die Liebe. Ein eindringlich geschriebenes Buch. Absolut lesenswert und empfohlen von Alfons Huckebrink
Die Biografieempfehlung des Monats November 2014
Dava Sobel, Galileos Tochter. Berlin BvT: 2008; Berlin Verlag: 1999.
Der in 6 Teile und 33 Kapitel unterteilte Roman befasst sich mit dem Leben von Galileos Lieblingstochter Virginia, die im Alter von gerade 13 Jahren in ein Kloster gegeben wurde, dort den Namen Suor Maria Celeste führte und ein Leben in Armut und Klausur verbrachte. Sie ging mit zwei weiteren Kindern aus einer illegitimen Verbindung des Vaters mit der Venezianerin Marina Gamba hervor und wurde am am 13. August 1600 geboren. Sie war offenbar ungewöhnlich begabt und für die damaligen Verhältnisse erstaunlich gebildet und belesen, sie blieb ihrem Vater wie einem Schutzheiligen ergeben. Daval Sobel zeichnet das Bild einer sehr engen und liebevollen Vater-Tochter-Beziehung. Sie las die Briefe und unterstützte ihren Vater während der Zeit seiner Gefangenschaft und seines Prozesses, wie er liebte sie die Sterne, was sich u.a. in ihrem Namen ausdrückt. Dabei werden als Quelle die Briefe der Tochter an ihren Vater Galileo in die Erzählung eingefügt, deren Verfassung sich über einen Zeitraum von 20 Jahren erstreckt bis zu ihrem Tod 1634, 8 Jahre bevor Galileo selbs starb. Auch eine Auswahl von Ordensregeln der Heiligen Klara wird vereinzelt eingestreut, um das Leben in einem mittelalterlichen Kloster deutlicher zu veranschaulichen. Im Grunde bleibt die Tochter selbst in der Erzählung, die zeitweilig einer genauen Dokumentation gleicht, eher im Schatten ihres Vaters, was kritisch anzumerken ist. Denn bei aller Genauigkeit und dem Reichtum der Recherche, bei allem Einfühlungsvermögen in die Biografie Galileos bezieht sich der Titel des Buches ja nicht auf Galileo selbst, sondern auf Maria Celeste. Das Erstaunliche an Galileos Biografie ist sein ergebener Katholizismus und seine Unterwürfigkeit kirchlichen und weltlichen Autoritäten gegenüber. So erscheint erim Buch nicht als der Revolutionär, als der er heute so gerne hingestellt wird. Er wurde verurteilt, obwohl das Buch, um das es im Prozess ging, in Rom durch die Zensur gekommen war. Andererseits war er ein ungewöhnlicher Wissenschaftler, neugierig und Zeit seines Lebens bis ins höchste Maß wissensdurstig und erfinderisch und gab die Projekte, an denen er z.T. über ein Jahrzehnt arbeitete, niemals auf. Seine Erfindungen waren in der damaligen Zeit überaus nützlich, z.B. die Erfindungund Herstellung des Fenrohrs oder er erfand eine Methode, große Kirchenglocken zu gießen, ohne dass diese zersprangen. Den Unmut der Obrigkeit erweckte er wohl auch wegen der Art und Weise der Veröffentlichung seiner Theorien, da er auf die lateinische Sprache verzichtete, damit auch Schiffszimmerleute und andere Handwerker seine Erkenntnisse verstehen konnten. Empfohlen von Gudula Ritz.
Die Biografieempfehlung des Monats Dezember 2014
Juliette Gréco, So bin ich eben. München btb: 2013
"Je suis faite comme ça" - Der Titel zur 2012 in Paris erschienen Originalausgabe der Autobiografie von Juliette Gréco ist überaus passend ausgesucht. Er bringt die verschiedenen Facetten dieses unglaublichen Lebens zusammen, zieht sich wie ein roter Faden durch seine Wendungen.
Die Gréco gehört zu den wenigen lebenden Künstlerinnen, deren Bekanntheit so unbegrenzt, deren Ruhm so zeitlos ist, dass man sie bedenkenlos mit dem bestimmten Artikel zum Familiennamen nennen kann. Noch immer gibt sie Konzerte. Ihre Besucher entstammen allen Altersklassen und gleich viel wie Zuhörer sind sie zumeist Bewunderer dieser außergewöhnlichen Frau.
Die wird 1927 in Montpellier geboren, verbringt ihre ersten Lebensjahre mit den Großeltern auf deren Landsitz bei Bordeaux. Ihre Mutter hält es während der deutschen Okkupation mit der Résistance. Sie wird deportiert. Im Alter von 16 Jahren werden Juliette und ihre ältere Schwester ebenfalls von der Gestapo verhaftet und gefoltert.
Nach der Befreiung sympathisiert sie mit den Kommunisten, lebt in St. Germain und wird Schauspielerin. Im Café de Flore trift sie auf Jean Paul Sartre, der ihr das erste Chanson schreibt, sie zum Singen ermutigt, und Simone de Beauvoir. Sie begegnet Charlie Parker und befreundet sich mit Miles Davis. Mit ihrem Outfit - schwarzes Kleid, blasser Teint, Pagenkopf - avanciert sie zur Stilikone der Existenzialisten. Sie arbeitet zusammen mit dem Dichter Jacques Prévert, dessen Gedicht "Les feuilles mortes" sie interpretiert, mit Boris Vian, Jacques Brel, Charles Aznavour und Serge Gainsbourg. Bis zu deren Tod verbindet sie eine enge Freundschaft mit Francoise Sagan. Sie war mehrmals verheiratet, einmal mit Michel Piccoli.
Und immer gilt ihr der Anfang eines ihrer berühmtesten Chansons als Lebensmaxime: Je suis comme je suis / Je suis faite comme ça". Auch heute noch, da sie längst ein nationales Monument und eine international gefeierte Botschafterin des französischen Chansons geworden ist, steht sie zu ihrer Meinung.
"Ich habe immer Stellung bezogen, leise, aber bestimmt", schreibt sie in ihrer gut lesbaren, zudem lesenswerten Autobiografie. Eine von vielen charmanten Ideen darin ist das abschließende "ABC meines Lebens". Den Buchstaben "G" repräsentiert das Stichwort Gehorsam. Dazu bemerkt sie lakonisch: "Dieses Wort habe ich aus meinem Wortschatz gestrichen." Die Gréco ist gewiss eine gute Autorin des eigenen Lebens.
Empfohlen von Alfons Huckebrink