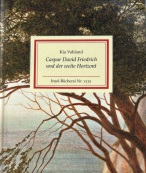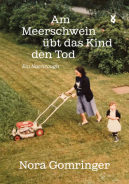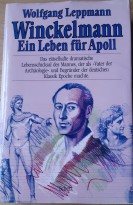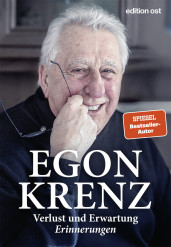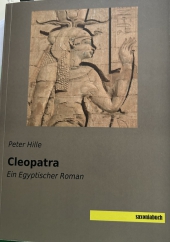Autor des eigenen Lebens werden: Die Website für Literatur und autobiografische Aufmerksamkeit.
Lesenswert:
Neue Rezension unseres Buches: Vom Helden zum Autor des eigenen Lebens
darin: Die fünf besten Bücher für neue Perspektiven
- Joseph Campbell: Der Heros in tausend Gestalten. Neuübersetzung aus dem Amerikanischen von Michael Bischoff. Berlin: Insel Verlag 2022
- Döris Dörrie: «Die Heldin reist». Zürich: Diogenes 2022
- Max Frisch: Mein Name sei Gantenbein. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1975.
- Gudula Ritz-Schulte, Alfons Huckebrink: Autor des eigenen Lebens werden. Anleitung zur Selbstentwicklung. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer 2012
- Doris Dörrie: Leben, Schreiben, Atmen. Zürich: Diogenes 2019
Alles Gute Ihnen und die besten Wünsche für ein glückliches Neues Jahr 2026! Ein Friedensjahr? Eine Hoffnung, der wir unseren Ausdruck verleihen können.
Die Biografieempfehlung des Monats Januar 2026
Kia Vahland: Caspar David Friedrich und der weite Horizont.
Berlin: Insel 2024
Caspar David Friedrich (CDF) wurde 1774 geboren und ist 1840 gestorben. Diese kurz gehaltene und reich bebilderte Biografie beschäftigt sich aber weniger mit der Chronologie lebensgeschichtlicher Daten, sondern vielmehr mit der Entstehung der einzelnen Gemälde an den verschiedenen biografischen Landmarken des Malers. CDF wird zu den Romantikern gezählt, die nach der Französischen Revolution sich vom Naturalismus abwendeten. Sie wollten vielmehr ihre Sinneseindrücke darstellen und sind darin Vorläufer des Impressionismus. Seine Protagonisten sind Reisende, Suchende, Menschen, die innehalten und ihr Verhältnis zur Natur und zu sich selbst neu bestimmen möchten.
CDF wächst in Greifswald als eines von acht Kindern auf. Sein Vater, der Seifen und Kerzen herstellt, engagiert einen Theologiestudenten als Hauslehrer. CDF bittet seinen Vater darum, Zeichenunterreicht nehmen zu dürfen. Vielleicht will der Vater dem Sohn diesen Wunsch nicht abschlagen, weil dieser schon früh tragische Verluste zu verkraften hat. Als er sechs Jahre alt ist, stirbt seine Mutter. Einige Jahre später bricht sein Bruder beim Schlittschuhlaufen ins Eis und ertrinkt, nachdem er CDF gerettet hat. In Greifswald nimmt er Zeichenunterricht, was in der Region ziemlich unüblich ist, und mit 20 Jahren tritt er in Kopenhagen in die Kunstakademie ein, die einen hervorragenden Ruf hat. Seine Lehrer gehören zu den bedeutendsten dänischen Landschaftsmalern der Epoche. Nach vier Jahren wechselt er an die Kunsthochschule in Dresden und begeistert sich für das Zeichnen mit Tusche. Dabei begibt er sich auf ausgedehnte einsame Wanderungen und versucht die Natur zu ergründen, setzt aber bei seinen Gemälden auch Hohlspiegel als technische Hilfsmittel ein. Er sucht die Anerkennung Goethes und beteiligt sich an einem Kunstpreis, den dieser ausgelobt hat. Die Qualität seiner Zeichnungen wird anerkannt, er erhält die Hälfte des Preisgeldes, Goethe kann aber mit den Themen des Künstlers nichts anfangen. Ende 1812 stellt CDF gleich 11 Ölgemälde in Weimar aus, und wird von den Rezensenten zerrissen. Wodurch CDF sich nicht beirren lässt. Doch am Hof von Weimar kommt der Maler gut an. CDF ist ein Romantiker. Sein Protestantismus sucht das Göttliche nicht im Pathos, sondern in der (subjektiven) Anschauung der Natur. Dabei will er keine Interpretation vorgeben, sondern versuchen geistig anzuregen und in den Beschauern Gedanken, Gefühle und Empfindungen zu erwecken, und wären sie auch nicht die seinen.
Seine berühmten Werke werden von Kia Vahland empathisch beschrieben, als seien sie lebendige Anteile des Künstlerlebens, einzigartige, z.T. in ihrer Sicht absurde und surreale Meisterwerke, die jeden Betrachter ins Hier und Jetzt und vielleicht zu sich selbst führen können, findet Gudula Ritz.
Die Biografieempfehlung des Monats Dezember 2025
Nora Gomringer: Am Meerschwein übt das Kind den Tod. Ein Nachrough. Berlin und Dresden: Voland & Quist 2025
Mama starb sechzehn Tage vor Weihnachten und saß achtzehn Tage vor Weihnachten noch an ihrem Rechner, beglich Rechnungen, die in den zwanzig Tagen Krankenhaus aufgelaufen waren, und bestellte uns allen Weihnachtsgeschenke, die sie in verschiedenen Katalogen angekreuzt hatte. So war sie tot und alle paar Tage kam ein Paket an, von dem ich nur annehmen konnte, für wen es wohl bestimmt war.
Die Lyrikerin Nora Gomringer (*1980) trauert und erinnert sich an ihre Mutter Nortrud (1941-2020). Keine herkömmlichen Erinnerungen, keine Lebensbeschreibung - sie umkreisen vielmehr eine lebenslange Beziehung, die grob vereinfacht gern als Mutter-Tochter-Verhältnis bezeichnet wird.
Ich schreibe ihr hinterher als vermissende Tochter, als wütende Frau, als verstummte Dichterin und wundere mich, wie wenig sie sich beschwören lässt, wenn ich es will, beschreibt sie selbst die Bemühungen um ihre verstorbene Mutter. Ihr Kollege Tobias Lehmkuhl lobt sie dafür im Deutschlandfunk: "Dem sprunghaften Wesen der Erinnerung verleiht Gomringer dabei eine Form, die ihren eigenen Rhythmus besitzt." Er findet dafür die Bezeichnung Auto-Essayistisch. Und das trifft es wohl.
Ohne die unglückliche Beziehung zu ihrem berühmten Mann Eugen Gomringer (1925-2025), Erfinder und Star-Autor der Konkreten Poesie, in Augenschein zu nehmen, ließe sich das Leben der Nortrud Gomringer von beider Tochter kaum erzählen. Ihre Skrupel wachsen und das Trügerische jedes Erinnerns ist ihr bewusst. Darf ich das hier so erzählen? Sollte ich eher Gespräche führen und diese verschriftlichen? Was ist eherliches Erzählen, was ist verwerflich an einer Lüge? Ist nicht jedes Erinnern an die Eltern halbe Wahrheit? Wie viel Selbsterfindung, wie viel Selbstmitleid sei jedem zugestanden? Wer eher noch als ich sollte vom Trauern berichten und dabei schildern, was und wen man betrauert und warum? Das Fassbare ihrer Erinnerung ist der bewusste Ausdruck ihrer Trauer. Um die tote Mutter, aber wohl auch um sich selbst.
Nora Gomringer ist die einzige Tochter von Nortrud und Eugen. Sie hat sieben ältere Halbbrüder. Zwei Söhne bringt die Mutter in ihre Ehe mit Eugen mit. Fünf weitere stammen aus verschiedenen Beziehungen des Vaters. Komplizierte Familienverhältnisse. Als Hauptschullehrerin beschäftigt sich Nortrud Ottenhausen als eine der Ersten mit der Poesie von Eugen Gomringer. Ihre Begeisterung überträgt sich bald auf die Person des Dichters. Sie verliebt sich in ihn, schließlich heiraten sie. Später promoviert sie in Literaturwissenschaft über Lion Feuchtwanger, was nicht nur ihre Tochter als Akt der Emanzipation begreift.
Ihr Vater ist notorischer Fremdgänger mit etlichen außerehelichen Beziehungen. Ihre Mutter ist darüber oft verzweifelt, wird depressiv, beginnt zu trinken. Wenn die Autorin heute gefragt wird, wie sie lebten, antwortet sie: Wie mit einem Gunter Sachs der Poesie. Eine erstaunliche Antwort, die das vertrackt Tragische des Zusammenlebens auf den Begriff bringt. In diesem Geflecht kommt Nora schon früh die Rolle einer Ausgleicherin zu, also jemandes, der tröstet und die Mutter auffängt, wenn der Kummer sie überwältigt. Erschütternd die Erinnerung an einen Sylvesterabend, den das kleine Mädchen allein mit der Mutter verbringt. In regelmäßigen Abstand muss sie eine Nummer in Paris anrufen, die zur Rezeption des Hyatt-Hotels gehört, wo der Vater mit einer Freundin feiert. Jedesmal hört sie, dass Mister Gomringer nicht erreichbar sei. Den ganzen Abend über sitzt die Mutter neben ihr am Tisch, raucht und betrinkt sich. ... Partnerin eines schreibenden Mannes zu sein, ist eine Kunst für sich, erkennt Nora Gomringer im Kapitel Ehefrauen rollender Steine, denn diese Frauen sind Künstlerinnen des Wartens, webende Penelopes. Aus ihrer eigenen Rolle an der Seite ihrer Mutter entlässt sie deren Tod am 08.12.20, sie wird die entlassene Schlichterin. Ihr Vater Eugen stirbt als Hundertjähriger am 21.08.25.
Ein berührendes Buch über die Unausweichlichkeit des Endes, mitreißend verfasst und als Lektüre ein seltener Hochgenuss, beschreibt Alfons Huckebrink seine Leseerfahrung.
Die Biografieempfehlung des Monats November 2025
Wolfgang Leppmann: Winckelmann. Ein Leben für Apoll. Bern und München: Scherz 1982
Ich glaube, ich bin nach Rom gekommen, denjenigen die Rom nach mir sehen werden die Augen ein wenig zu öffnen.
Die Novemberausgabe unserer Biografieempfehlungen greift einmal mehr im Wortsinn einen im Antiquariat gesichteten Zufallsfund auf: die Lebensbeschreibung des Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) aus der Feder des renommierten Biografen Wolfgang Leppmann (1922-2002).
Der Autor eröffnet seinen detailreichen und spannend verfassten Überblick mit der Sichtung einer Kriminalakte. Am 1. Juni 1768 trifft Winckelmann auf der Heimreise nach Rom in Triest ein und quartiert sich inkognito als "Signor Giovanni" in der Locanda Grande ein. Dort macht er die Bekanntschaft von Francesco Arcangelis und wird von dem vorbestraften Koch am 8. Juni brutal ermordet. Die zahlreichen Spekulationen und Vermutungen, die sich auch angesichts der homosexuellen Orientierung des Opfers um den Mord ranken, schiebt Leppmann beiseite und zitiert stattdessen ausführlich aus Arcangelis' eigenem Bericht aus der Gerichtsakte, die er als wahrheitsgetreuer einstuft als sämtliche späteren Rekonstruktionen.
Im Frühjahr 1768 tritt Winckelmann nach langen Jahren in Italien aus unerklärlichen Gründen eine Reise zum Besuch Sachsens und Preußens an, fühlt sich bald unpässlich (Torniamo a Roma) und verlässt seinen Begleiter Cavaceppi in Wien. Als dieser in Berlin eintrifft, wird er zu Friedrich II. gerufen, der dem entsetzten Italiener die Nachricht vom Tod des Freundes überbringt.
Welch ein Leben. Aus einem Provinznest in der Altmark in den Palast eines römischen Kirchenfürsten. Geboren in Stendal als Sohn eines Schuhmachers in ärmlichen Verhältnissen schlägt er sich als Hilfslehrer, später als Privatlehrer durch. Sein Hauptaugenmerk richtet sich auf das Studium wissenschaftlicher Bücher zur Philologie, Philosophie und Geschichte, zu denen er umfangreiche Exzerpte hinterlässt. 1748 wird er Bibliothekar des Grafen Heinrich von Bünau und macht dort die Bekanntschaft des päpstlichen Nuntius in Sachsen, der ihm die Stelle eines Bibliothekars in Rom anbietet. Voraussetzung dafür ist allerdings der Übertritt zum Katholizismus, die Winckelmann nach langem Ringen mit sich selbst akzeptiert. Er siedelt im Herbst 1755 nach Rom über und tritt in die Dienste des Kardinals Alessandro Alberti, der ihm weitgehend freie Hand für seine Forschungen lässt. In Rom vollendet sich seine Entwicklung zum Begründer der wissenschaftlichen Archäologie. Bereits sein erstes Buch Gedancken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst (1755) findet große Beachtung und macht ihn in Europa bekannt. Prägende Wirkung entfaltet sein Standardwerk Geschichte der Kunst des Alterthums, das 1764 in Dresden erscheint. Winckelmann ist befreundet mit dem Maler Anton Raphael Mengs (1728-1779), besucht Neapel, Pompeji und Herculaneum, stoppt dort das Treiben schamloser Schatzräuber und gewinnt bedeutende Erkenntnisse, die in seine zukünftigen Schriften einfließen. Mit der Suche nach der klassischen Schönheit, insbesondere seiner Begeisterung für den Apoll-Torso vom Belvedere, begründet er den geistigen Klassizismus. Das klassische Griechenland-Bild, bis in unsere Tage hinein wirkmächtig, ist von Winckelmann geschaffen. Zu einer persönlichen Begegnung mit Goethe, der sich 1804 dazu entschließt, Winckelmanns Briefe an den Hofrat Berendis herauszugeben und zu diesen eine umfangreiche Einleitung schreibt, ist es wegen seines traurigen Endes in Triest nicht gekommen. Goethe urteilt über ihn: "Wenn bei sehr vielen Menschen, besonders aber bei Gelehrten, dasjenige, was sie leisten, als die Hauptsache erscheint und der Charakter sich dabei wenig äußert, so tritt im Gegenteil bei Winckelmann der Fall ein, daß alles dasjenige, was er hervorbringt, hauptsächlich deswegen merkwürdig und schätzenswert ist, weil sein Charakter sich immer dabei offenbart.
Und das Schicksal seines Mörders: gefasst, geständig, gerädert. Die Leiche öffentlich zur Schau gestellt. (Das Licht der Aufklärung wurde erst 30 Jahre später von den französischen Revolutionstruppen nach Triest getragen.)
Diese lesenswerte Studie über den großen Winckelmann ist in verschiedenen Ausgaben immer noch gut erhältlich und wird gerne empfohlen von Alfons Huckebrink.
Die Biografieempfehlung des Monats Oktober 2025
Egon Krenz: Verlust und Erwartung. Erinnerungen. Berlin: edition ost im Verlag Das Neue Berlin 2025
Es wird nicht gelingen, die DDR zu einer Fußnote der deutschen Geschichte herabzuwürdigen. Sie ist mindestens ein Kapitel. Und nicht das Schlechteste.
Im dritten und abschließenden Band seiner Memoiren gibt Egon Krenz (EK) Rechenschaft über sein Handeln sowie Einblick in sein Denken seit der Jahreswende 1988/89. Das Eingangszitat kann als Fazit dieses Prozesses gewertet werden.
Der Autor, geb. 1937, leistet nach einem Lehrerstudium Dienst in der Nationalen Volksarmee. Von 1974 bis 1983 ist er 1. Sekretär der Freien Deutschen Jugend, danach avanciert er zum Mitglied der Partei- und Staatsführung der DDR und wird im Herbst 1989 in der Nachfolge Erich Honeckers Generalsekretär der SED, Staatsratsvorsitzender und Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates. Im Dezember 1990 tritt er von allen Funktionen zurück und ist seitdem parteilos. Als Autor schreibt er mehrere erfolgreiche Bücher.
Ein langes, bewegtes Leben, aber nur 49 Tage davon steht EK nach dem Sturz Honeckers an der Spitze der SED, ein recht kurzer Zeitraum, jedoch geprägt durch Zuspitzungen und Entscheidungen von welthistorischer Bedeutung.
Bereits im Verlauf des Jahres 1988 spitzt sich die Situation in der DDR entscheidend zu. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wächst, ebenso die Uneinsichtigkeit innerhalb der Staats- und Parteiführung; besonders im Sommer und Frühherbst 1989 reagiert sie mit unverständlichen, tlw. panikartigen Entscheidungen und Maßnahmen auf die Situation. Das Land steht vor dem Kollaps, vor der Implosion... Einen Spielraum für eine erfolgreiche Kurskorrektur gibt es zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr. Diese Möglichkeit wurde, so EK, seit der Ablösung W. Ulbrichts 1971 leichtfertig verspielt.
Wir lebten über unsere Verhältnisse, häuften Schulden an und gerieten in Abhängigkeiten, von denen wir nicht mehr loskamen.
Die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse geraten in Bewegung. Der Ruf nach Reformen mündet im Traum eines reformierten Sozialismus, der sehr schnell ausgeträumt ist und von der Realität düpiert wird. "Hier findet nicht die Vereinigung zweier gleicher Staaten statt", befindet der westdeutsche Innenminister Wolfgang Schäuble 1990. Das andere Deutschland geht in der BRD auf.
EK versteht es, die Dynamik und Dramatik dieser Monate und Jahre anschaulich und spannnend wiederzugeben. Sein persönlicher Anteil an den inneren Auseinandersetzungen und ihren weltpolitischen Implikationen kommt dabei nicht zu kurz. Seinen entscheidenden Einfluss, den er zurecht betont, macht er geltend auf den gewaltlosen Verlauf der Demonstrationen im Herbst 1989. Dieser wird ihm von drei namhaften Persönlichkeiten attestiert: dem Philosophen Wolfgang Harich, dem damaligen FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher und Peter Gauweiler (CSU).
Es ist EK und nicht etwa Gorbatschow, der sich zusammen mit Fritz Streletz (Chef des NVA-Hauptstabes) an die Führung der sowjetischen Truppen mit der Bitte wendet, die turnusmäßigen Herbstmanöver abzublasen und die Soldaten in den Kasernen zu belassen. Beim Untergang der DDR fließt kein Blut.
Trotzdem wird EK 1997 von der bundesdeutschen Justiz wegen "Totschlags und Mitverantwortung für das Grenzregime der DDR" zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt, von denen er knappe vier Jahre verbüßen muss. Auch die Eindrücke und Erfahrungen dieser schweren Jahre werden dem interessierten Leser / der Leserin nicht vorenthalten.
Auch mit meinen Büchern will ich dazu beitragen, dass die Verdrehungen und Unschärfen, die Lügen und Unwahrheiten, die - mit politischer Absicht oder aus Unwissenheit über die Vergangenheit verbreitet - auch als solche erkannt werden.
Lautet das Kredo des EK. Wer sich auf die Lektüre seiner Memoiren einlässt - und eine solche ist gerade auch dem / der westdeutschen Leser / Leserin anzuraten -, wird wissen, worauf er / sie sich einlässt. EK schreibt an gegen die vorherrschende oder angeordnete (Bundesjustizminister Klaus Kinkel 1991: "Es muss gelingen, das DDR-System zu delegitimieren.") Delegitimierung der DDR.
Ein immer noch aktuelles Kapitel deutscher Geschichte wird hier erzählt. Auf Krenz' insgesamt drei Memoirenbände werden auch künftige Historiker ebenso wie politisch interessierte Bürger:innen mit Gewinn zurückgreifen können, meint Alfons Huckebrink.
Die Biografieempfehlung des Monats September 2025
Peter Hille: Cleopatra. Ein Egyptischer Roman. Dresden: Saxoniabuch 2018 (Nachdruck des Originalausgabe aus dem Jahre 1902)
Antonius presste seinen feuerroten begehrlichen Mund auf ihre feinen Lippen: diese begehrliche Wunde des Genusses.
Geheimnisvoll träumerisch, wie die Weiber lächeln, die ihre Reize geehrt wissen, lächelte Cleopatra.
Mit diesem Roman über Cleopatra knüpfe ich an die Biografie von Stacy Schiff vom Juni diesen Jahres an.
Peter Hille (1854-1904), ein heute leider weitgehend übersehener Autor, widmet sich mit viel Sachkundigkeit und verblüffendem Gestaltungsvermögen dem Leben der berühmten Herrscherin des antiken Ägyptens.
Die fiktive Ausstattung der Persönlichkeiten stimmt treffend mit ihrer Darstellung in der umfangreicheren und aktuelleren Biografie überein, ist ähnlich modern in ihrer Ausprägung (im Unterschied zu den eher patriarchalisch geprägten Biografien, die auf römischen Quellen beruhen, z.B. Cicero).
Diesen Effekt der Kürze erreicht der Autor durch Dialoge, die den Roman eher wie ein Theaterstück erscheinen lassen. Besonders deutlich wird dieser Eindruck in der langen schwankhaft anmutenden Verkleidungsszene, in der Cleopatra und Antonius ihre Brautnacht als 'einfache Leute' in einer Schänke Alexandriens feiern. Viel Kolorit. Ein Roman wie ein Gemälde.
Nein alles, nur keine Langeweile!, so lautet die Lebensmaxime der Königin. Durch die Art der Äußerungen spürt man schon die Auslegungen der Charaktere. Am Anfang war es Cäsar und die berühmte erste Begegnung der beiden in gemeinsamer Gefangenschaft im Palast von Alexandria, als sich Cleopatra in einem Sack mit Hilfe ihres Sklaven in ihren Palast hineinschmuggeln lässt. Dort sucht Cäsar Schutz vor den Truppen des Pompeius.
Cäsar ist das erste Wort des Romans. Durch die Dialoge werden die unterschiedlichen Charaktere des strengen und disziplinierten Cäsar und des lebensfrohen Antonius deutlich, so auch die unterschiedlich geprägten Beziehungen zu Cleopatra, die durch den Tod der beiden Männer beendet werden. Die erzählerische Konstante ist Cleopatra, die sich in ihrer Selbstbestimmung sehr von den Römern und insbesondere von den Römerinnen abhebt, die von Cleopatra durchweg als tugendhafte Matronen bezeichnet werden. Die Aermsten. Caesar ward ernst. "Die Aermsten? Die römische Matrone ist niemals arm. Das merke dir, Cleopatra!" Sucht sie bei Cäsar den Beistand gegen ihren Bruder Ptolemaios XIII., so sucht und findet sie bei Antonius die erfüllende Liebe. "Du meine Nilotter - komm und umschlinge mich!" Sie erschauert angesichts dieses Verlangens und erblickt in dem von seiner Aufregung fasst aufgelösten Mann - das Rom, das kalt erobernde. gewalttätig vernünftige Rom, das sie anfleht, von ihrem egyptischen Arm erobert zu sein. Ein historisch bedeutsamer Moment, den sie festhält, bevor sie sich ihm hingibt.
Das Buch wird lesenswert durch die einzigartige, poetisch nachklingende Prosakunst Peter Hilles. Deshalb soll an dieser Stelle ausdrücklich auch an den im kleinen ostwestfälischen Erwitzen geborenen und in Berlin begrabenen Dichter verwiesen werden, dessen Werk geschätzt wurde u.a. von Else Lasker-Schüler oder Erich Mühsam. Ein Künstler mit einem unsteten Lebenslauf, der ein großes Werk hinterlässt. Mehr über ihn und seine Dichtung erfahren Sie auf den Seiten der Peter Hille - Gesellschaft, die ich Ihnen ebenso wie Hilles Cleopatra-Roman sehr gern empfehle. Viel Spaß beim Entdecken, wünscht Gudula Ritz.
(Hinweis: Orthografie in den Zitaten beibehalten.)
Die Biografieempfehlung des Monats August 2025
Jennifer Lesieux: Rose Valland und die Liebe zur Kunst. Die Frau, die 60000 Kunstwerke rettete. München: Elisabeth Sandmann Verlag 2024, übersetzt von Thomas Stauder
"Am 28. August 1939 verließen in der Morgendämmerung acht Lastwagen den Cour carrée genannten Innenhof des Louvre und fuhren von Paris aus in Richtung Loire. Ein eigenartiger Tross von Nymphen, Kriegern, antiken Göttern und rundlichen Putten ergriff inkognito die Flucht. Die Mona Lisa schwankte in gepolsterter Dunkelheit hin und her, im Rhythmus der Kurven und Schlaglöcher."
Die Liebe zur Kunst. Der deutschsprachige Titel ist im Vergleich zum französischen (Rose Valland, L'éspionne à l'œvre.) langweilig und unterschlägt die wahre Leistung von RV, so als sei es lediglich um ihre Liebe zur Kunst gegangen und nicht ebenso sehr um ihr politisches Engagement für die Résistance. Gegen die deutschen Kunsträuber und Barbaren und nach dem Krieg um das Aufspüren und die Rückführung der verschleppten Kunstschätze. Und diese Unterschlagung ihrer erstaunlichen Lebensleistung ist ein typisches Merkmal des Umgangs mit dieser Frau und ihrer erstaunlichen Biografie. Die französische Ausgabe erschien 2023 in Paris.
RV war eine unscheinbar wirkende, doch wichtige und zielstrebige Persönlichkeit während der deutschen Besatzung in Paris. Ihr ging es nicht um Ruhm und Ehre, sondern um den Erhalt wertvoller Kunstgegenstände und um Gerechtigkeit, z.B. den bestohlenen und beraubten jüdischen Eigentümern gegenüber. Um dieses während der Besatzung durch die deutsche Soldateska erfolgreich tun zu können, musste sie vor allem unauffällig erscheinen. So war sie einfache Mitarbeiterin des Jeu de Paume, des Pariser Impressionisten-Museums, und beobachtete genau, wer dort welche Kunstwerke im Namen des Führers, dessen Lieblingsbild Jan Vermeers Der Astronom gewesen ist, entwendete und wohin die Kunstwerke zur "Aufbewahrung" gelangen sollten. Sie notierte, was sie den Schnippseln aus Papierkörben entnahm, auf Karteikarten und verbarg ihre Deutsch-Kenntnisse. Vor allem Göring bereicherte sich persönlich um tausende wertvoller Werke, plünderte aber auch im Auftrag des Führers. Und ebenso der SS-Obersturmführer und Kunst„händler“ Bruno Lohse, Beauftragter Görings, dem sie bei den Nürnberger Prozessen zuletzt begegnete, ging im Museum ein und aus. Vor der Besatzung war sie an der Evakuierung des Louvre beteiligt, und nach der deutschen Kapitulation widmete sie sich der Aufspürung der geraubten Werke im befreiten Deutschland.
RV wird am 1.11.1898 als einzige Tochter eines Hufschmidts und einer Hausfrau in der französischen Provinz geboren. Sie ist sehr begabt, dank eines Stipendiums kann sie die höhere Schule im nahegelegenen Grenoble besuchen und später die Kunsthochschule in Lyon, wo sie ebenfalls zu den Besten gehört. Im Alter von 24 Jahren gelangt sie nach Paris, wo sie im neu gegründeten Museum Jeu de Paume als "Museum der Zeitgenössischen künstlerischen Schulen des Auslands“ eine Stelle als Assistentin erhält. Sie erlebt das Paris der 20er Jahre, der Abstand zu ihrer strengen traditionellen Erziehung ihres Heimatortes kann nicht größer sein. Die Eltern sterben früh, von der kleinen Erbschaft kann sie eine Wohnung in der Rue de Navarre 4 kaufen, die sie bis zu ihrem Tod behalten wird. Dort zieht ein paar Jahre später ihre Lebensgefährtin Joyce ein, eine Beziehung, die in der damaligen Zeit geheim bleiben muss. Sie erhält zahlreiche Ehrungen und Orden, z.B. die „Medaille de la liberté“, den Rang eines Hauptmanns des französischen Militärs. Der bekannte Film The Train (Der Zug) mit Jeanne Moreau, Burt Lancaster und Michel Simon beruht auf den wahren Gegebenheiten, die RV kurz vor Ende des Krieges mit Hilfe der französischen Eisenbahner zur Rettung tausender Kunstwerke organisiert hatte. Ihre Erfahrungen hielt sie im Buch Le Front de l‘art fest, das Manuskript der Fortsetzung ist verschwunden. Ihre eigene Zurückgezogenheit wird nach dem Krieg denjenigen zum Vorteil, welche die unbequemen Wahrheiten lieber im Dunkeln lassen. Sie stirbt am 18. September 1980 – kein Vertreter des Staates erweist ihr an ihrem Grab die Ehre, der Offizierin der Ehrenlegion, der Schönen Künste und Literatur, Trägerin der Widerstandsmedaille und des deutschen Bundesverdienstkreuzes. Immerhin findet am 16. Oktober im Pariser Invalidendom noch eine Trauerfeier statt. Das Buch ist für eine Biografie ungemein spannend geschrieben. Es vermittelt neben einer Fülle kunsthistorischer Zusammenhänge einen dichten Eindruck vom Leben im besetzten Paris sowie von der Atmosphäre in Deutschland unmittelbar nach der Kapitulation. "Die Nazis hatten versucht, den Kubismus zu beseitigen, aber ihre Städte waren selbst kubistisch geworden, mit gebrochenen Formen und Farben von graumetallisch bis schmutzbraun", lautet Rose Vallands präzis gefasstes Fazit angesichts der Verwüstungen und des Elends. Absolut lesenswert vor allem wegen ihrer nun wieder ins Licht gerückten Lebensleistung, befinden Gudula Ritz und Alfons Huckebrink.
Die Biografieempfehlung des Monats Juli 2025
Frank Wagner, Ursula Emmerich, Ruth Radvanyi (Hrsg.): Anna Seghers. Eine Biographie in Bildern. Mit einem Essay von Christa Wolf. Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag 1994
Was ist das, ein Unglück?, dachte Anna. Ist es wie der Hof dort unten und wie das Zimmer dort hinten? Oder gibt es auch noch andere Unglücke, rote glühende leuchtende Unglücke? Ach, wenn ich so eins haben könnte! (aus: Grubetsch, 1927)
Im Bookshop der Ruhrfestspiele 2025 in Recklinghausen stieß ich auf die Biografie in Bildern über die Schriftstellerin Anna Seghers (1900-1983), geb. Reiling, verh. Radvanyi, die ich Ihnen in diesem Monat gerne empfehle.
1928 wird der jungen Autorin der Kleist-Preis für ihre beiden Novellen Grubetsch und Aufstand der Fischer von St. Barbara zuerkannt. In beiden Texten erkennt Hans Henny Jahnn "eine starke Begabung im Formalen" und führt in seiner Begründung weiter aus: "Darum verbrennt Alles, was als Tendenz erscheinen könnte, in einer leuchtenden Flamme der Menschlichkeit. Ich fand in diesen Novellen unter allen Einsendungen nicht den umfassendsten, aber vielleicht den reinsten Beitrag zur Wiederentdeckung des Daseins ohne Apotheose."
Die gebürtige Mainzerin erlangt 1942 mit ihrem Werk Das siebte Kreuz. Roman aus Hitlerdeutschland internationales Ansehen. Es erscheint zuerst auf Englisch in den USA und wird durch Ausgaben für die US-Streitkräfte und eine Comic-Strip-Version ein großer Erfolg. Eine deutsche Ausgabe erscheint bei El Libro Libre in Mexiko, wo sich die Seghers im Exil aufhält. Im selben Jahr erhält sie die Nachricht, dass ihre Mutter Hedwig Reiling nach Lublin deportiert und dort umgekommen ist. Zwei Jahre darauf wird der Roman durch Fred Zinnemann und mit Spencer Tracy in der Rolle des Georg Heisler in Hollywood verfilmt. 1943 erleidet sie einen schweren Verkehrsunfall und arbeitet während der langen Rekonvaleszenz an Der Ausflug der toten Mädchen. 1950 wird sie von W. Pieck, dem Präsidenten der DDR, zum Gründungsmitglied der Deutschen Akademie der Künste berufen. 1981 wird sie Ehrenbürgerin der Stadt Mainz. Sie wohnt bis zu ihrem Lebensende am 01.06.1983 in Berlin-Adlershof.
'Von Mainz in die Hauptstadt', 'Exil in Frankreich und Mexiko', und 'Wieder in Deutschland' lauten denn auch die Überschriften der drei groß angelegten Kapitel dieser ebenso informativen wie unterhaltsamen Bildbiografie, an der auch Seghers Tochter Ruth Radvanyi als Herausgeberin beteiligt ist und die eingeleitet wird durch einen um Verständnis werbenden Essay von Christa Wolf. Der Leser findet darin neben den ausgesuchten Bildern und Abbildungen auch Textbeispiele aus ihren Werken, Interviews und Briefe sowie Äußerungen vieler Zeitgenossen wie Bruno Frei, Georg Lukács, Hans Mayer, Erich Wendt, Jorge Amado ... Er erhält einen fundierten Überblick über Person, Leben und Werk dieser herausragenden Schriftstellerin und wird vielleicht dazu angeregt, zu einem Buch von ihr zu greifen.
"Nun hat die Umwertung aller Werte auch sie erfaßt, [...], konstatiert Christa Wolf in ihrem Essay. Mit dem Ende der DDR hat sich die Wahrnehmung von Anna Seghers' Lebenswerk verdunkelt. Besonders ihre vordergründig unbeteiligte Haltung im Prozess gegen ihren Verleger Walter Janka 1956 (Aufbau Verlag) werden ihr zur Last gelegt. Ein "endgültiges" Bild, was immer das sein mag, stehe indessen noch aus und Christa Wolf hofft, "daß sie sich mit ihren besten Büchern aus dem Schutt der Geschichte, der auch über sie geschüttet wird, wieder herausarbeitet? Daß die Leistung einer Generation doch nicht auf Dauer dem Vergessen überantwortet wird [...]." Dazu wird diese Biografie, die bereits 1994 erschien, sicher beitragen. Anna Seghers und ihre Figuren? Was wäre das Jahrhundert ohne sie?, befindet Christa Wolf und dem ist nur beizupflichten, meint Alfons Huckebrink.
Die Biografieempfehlung des Monats Juni 2025
Stacy Schiff: Kleopatra. Ein Leben. München: Bassermann 2023, übersetzt von Helmut Ettinger und Karin Schuler
Diese Biografie der ägyptischen Herrscherin (69 v. Chr. -30 v. Chr.) aus mazedonisch-ptolemäischer Dynastie nimmt eine quellenkritische und somit feministische Perspektive ein. Sie ist mit feministisch aufgeklärtem Blick geschrieben worden. Es werden verschiedene zeitgenössische Quellen recherchiert sowie die nachfolgende Berichterstattung, Propaganda und Geschichtsschreibung analysiert. Die Quellen, die hauptsächlich über diese berühmte und einflussreiche Herrscherin aus Alexandria berichten, sind - später feindliche - römische Quellen und vor allem männliche Stimmen. In Rom besaßen Frauen einen anderen Status als im alten Ägypten, welches zu jener Zeit kulturell stark von Griechenland geprägt war. Vor allem Cicero war ein scharfzüngiger und eher spöttischer Schreiber im Hinblick auf Kleopatra. „Die Wahrheit ist durch römische Manipulationen verfälscht…“, lautet demnach ein Diktum Schiffs (S. 273). Die Juden hingegen verbanden ihre Herrschaft mit einem goldenen Zeitalter und dem Kommen des Messias.
Kleopatra erhob sich zunächst als Garantin einer besseren Welt über Rom. Sie übertraf ihre Herrscherkollegen an Reichtum und Einfluss; sie hatte zahlreiche mächtige Verbündete und öffnete ihre Speicher für das Volk, wenn es eine Missernte gegeben hatte. Rom erhielt umfangreiche Abgaben von ihr, später verbündete sie sich mit Julius Cäsar und hatte mit ihm einen gemeinsamen Sohn, Kaisarion, den einzigen legitimen Erben Cäsars, der allerdings von diesem offiziell nie anerkannt worden ist. Nach dessen Ermordung verbündete sie sich mit einem seiner Nachfolger, Mark Anton, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hatte, darunter zwei Söhne. Die Rivalität und der Streit zwischen Octavian, dem Adoptivsohns Cäsars, und Mark Anton spitzte sich zu, bis es zur Auseinandersetzung und dem Sieg Octavians kam, der die Zeit der Bürgerkriege beendete. Kurz nachdem Mark Anton gefallen war, nahm sich Kleopatra ihr Leben durch Gift.
Ihr Sohn und der älteste Sohn von Mark Anton mit Fulvia wurden von Octavian, dem späteren Kaiser Augustus, aufgespürt und getötet. Drei überlebende Kinder wurden von Octavia, der legitimen Ehefrau Mark Antons und Schwester Octavians großgezogen. Diese spannend geschriebene Biografie zu lesen, empfiehlt Ihnen Gudula Ritz.
Die Biografieempfehlung des Monats Mai 2025
Leonard Woolf: Mein Leben mit Virginia. Frankfurt: Schöffling & Co 2023, übersetzt von Ilse Stratmann
Diese Neuübersetzung der in den Jahren 1961-1969 bei Hogarth Press erschienenen autobiografischen Veröffentlichungen Leonard Woolfs (1880-1969) ist um wenige Anmerkungen der Herausgeberin Friederike Groth ergänzt. Es handelt sich um eine besondere Spielart innerhalb der Gattung Biografie, nämlich um Autobiografie, Paar-Biografie und Biografie zugleich.
Geschrieben aus der Perspektive des Ehemannes der berühmten Schriftstellerin Virginia Woolf behandelt sie deren Leben, das eigene Leben und gemeinsames (Er-)leben als Paar. Ebenfalls wird Zeitgeschichte in den Blick genommen, insbesondere die beiden Weltkriege, aber auch die Literaturgeschichte und die Entwicklung künstlerischer Gemeinschaften in jener Epoche des UK. Sehr anschaulich wird beschrieben, wie aus einem „Hobby“-Verlag ein kommerzieller Verlag, Hogarth Press, entstehen und überleben konnte.
LW wird im Jahr 1880 als eines von zehn Kindern geboren. Als er 12 Jahre alt ist, stirbt sein Vater, ein Jurist jüdischer Abstammung, der als Kronanwalt tätig ist. Er hinterlässt zu wenig Vermögen, als dass die Familie ihren aufwändigen Lebensstil in London fortsetzen könnte. Ein Stipendium am Trinity College in Cambridge ermöglicht ihm jedoch Kontakte zur intellektuellen Avantgarde, dem später als „Bloomsbury“ bezeichneten Kreis, zu dem auch Virginia Stephen, seine spätere Ehefrau, gehört, die eine berühmte Schriftstellerin werden sollte. Sie ist die Schwester von Thoby Stephen, einem der Mitglieder des Freundeskreises, der ein Leben lang von Bedeutung blieb. Auch Virginias Schwester Vanessa Stephen heiratet mit Eddy Wells in den gleichen Kreis liberaler Intellektueller ein. Die Autobiographie wirft einen authentischen Blick auf den Zeitraum von vor 80-100 Jahren, auf die beiden Weltkriege und wie sie aus UK-Sicht und aus der Perspektive eines jüdischen Briten erlitten wurden, auf persönliche Kontakte zu bedeutsamen historischen Persönlichkeiten, wie etwa Sigmund Freud, der nach seiner Flucht aus Wien vor den Nazis in der Nachbarschaft der Woolfes weilt. Überzeugend dargelegt und späterer feministischer Unkenrufe zum Trotz ist LW‘s Bemühen erkennbar, Virginia, die sehr wahrscheinlich unter einer damals noch nicht näher diagnostizierten bipolaren Störung leidet, zu Stabilität, Struktur und somit den Bedingungen für ihre künstlerische Entfaltung zu verhelfen.
Meine Notizen aus dem Jahr 1913 zeigen sehr deutlich die schnelle Verschlimmerung von Virginias Krankheit und meine Besorgnis. Von Januar bis August notierte ich fast täglich ihren Gesundheitszustand, ob sie arbeiten konnte, wie sie geschlafen hatte, ob sie Kopfschmerzen hatte; ab August chiffrierte ich meine Notizen.
LW übernimmt dann Verantwortung, die bei der Erkrankung eines Partners notwendig ist, sobald er/sie selbst die Verantwortung nicht übernehmen kann. Sobald es der Gesundheitszustand zulässt, nehmen sie gesellschaftliche Kontakte auf Wunsch von Virginia auf und verreisen sogar durch Deutschland nach Italien. Naiverweise glaubt Leonard, dass einem britischen Juden in Deutschland nicht mehr geschehen könne als einem Briten generell. Als sie jedoch während eines erwarteten Besuchs von Hermann Göring durch die jubelnden Massen bei Bonn fahren, im offenen Verdeck mit einem Krallenaffen auf der Schulter, und ihnen die Massen „Heil Hitler!“ zujubeln, gelingt ihm sogar eine Ironie ganz im Sinne seines britischen Humors. Unter dem Eindruck des Blitzkriegs und der Zerstörung des Verlagssitzes sowie der Detonationen in unmittelbarer Nähe erleidet Virginia einen Rückfall ihrer Erkrankung und wählt den bereits vorher in Erwägung gezogenen Freitod. Sie beschreibt in ihrem Abschiedsbrief ihre Angst, erneut krank zu werden und schildert, dass sie Stimmen höre (also unter Halluzinationen oder Pseudohalluzinationen leide). Dieses Werk ist mehr als Autobiografie LWs, denn als Biografie lesenswert und stellt einen eigenen Wert durch authentische Einblicke, die anschaulich gestaltet werden, sowie als historisches Dokument dar, findet Gudula Ritz.
Die Biografieempfehlung des Monats April 2025
Inge und Michael Pardon: Tulpanow. Stalins Macher und Widersacher. Die Biografie. Berlin: edition ost 2024
Schon während des Krieges gegen den deutschen Faschismus maßen die Sowjetregierung, unsere miltärische Führung und deren politische Abteilungen den Fragen der deutschen Kultur große Bedeutung bei.
Am 8. Mai 2025 jährt sich zum 80. Mal die Befreiung Europas vom Faschismus. Was läge näher, als anlässlich dieses Festtages das Leben eines Befreiers in dieser Rubrik vorzustellen.
Oberst Sergej Iwanowitsch Tulpanow lebte von 1901 bis 1984. Seine außergewöhnliche Lebensgeschichte wird von Inge und Michael Pardon, die ihn persönlich kannten und später Zugang zu seinem Privatarchiv erlangten, in ihrem Buch dargestellt.
Tulpanow wird ab 1945 als Kulturoffizier der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) ernannt. Innerhalb dieser leitet er die 'Verwaltung Propaganda', im Mai 1947 umbenannt in 'Informationsverwaltung', bis zu ihrer Auflösung im November 1949. In Ausübung dieser Funktion entwickelt er sich zu einer Schlüsselfigur der sowjetischen Deutschlandpolitik, die keineswegs aus einem Guss geschaffen ist. Vielmehr sind die Interessen der sowjetischen Führung in Außen- und Innenministerium, der Armee oder der KPdSU durchaus unterschiedlich und fließen in widersprüchliche Strategien ein; ein Umstand, der seiner eigenen Arbeit aus Moskau Argwohn und Misstrauen entgegenbringt. Aufgabe dieser Abteilung ist die Ingangsetzung gesellschaftlichen Lebens mittels Presse, Rundfunk, Theater und Verlagswesen. Tulpanow avanciert hier zum Brückenbauer zwischen vormaligen Kriegsgegnern, die nun gezwungen sind, miteinander auszukommen. Zu seinen Freunden zählen Persönlichkeiten wie Jürgen Kuczynski, Anna Seghers, Max Burghardt oder Markus Wolf. Wolfgang Leonhardt bezeichnet ihn noch 2005 in einem Gespräch im Literaturforum im Brecht-Haus Berlin als den entscheidenden Kulturoffizier neben Alexander Dymschitz. Beider "Interesse an Gustaf Gründgens, Jürgen Fehling, Max Pechstein, Heinrich Mann, Arnold Zweig, Bertolt Brecht und vielen war groß." Tulpanow spricht vorzüglich Deutsch und bricht in einer Rede zum Ableben Gerhart Hauptmanns eine Lanze für den diskreditierten Schriftsteller. 1949 wird er zum Generalmajor befördert und im Ergebnis einer kaum durchschaubaren Intrige aus Berlin abberufen. Trotz zahlreicher Einladungen darf er die DDR bis 1965, zum 20. Jahrestag der Befreiung, nicht mehr besuchen. 1975 wird er dort mit dem Orden 'Stern der Völkerfreundschaft' ausgezeichnet.
Nachvollziehbar ist das Hauptaugenmerk dieser vorzüglich recherchierten und flüssig verfassten Biografie auf Tulpanows Tätigkeit als Kulturoffizier gerichtet. Gleichwohl erhalten wir Aufklärung über das Schicksal seiner Eltern sowie zur wissenschaftlichen Tätigkeit nach 1949. Sein 1870 geborener Vater, der Agronom Iwan Alexeijewitsch, erhält als Findelkind, wie damals üblich, einen Blumennamen. Tulpanow leitet sich ab vom russischen Tulpan (=Tulpe). Seine Mutter Elsa Wassiljewna stammt aus dem lettischen Riga. Beide entwickeln eine enge Beziehung zu deutscher Sprache und Kultur. Die Mutter wird 1940 als angebliche Spionin erschossen. Der Vater stirbt in einem Lager in Kasachstan. Seine 5-jährige Tochter Dolores verhungert im von der Wehrmacht belagerten Leningrad. Vom Schicksal der Eltern erfährt Tulpanow erst nach seiner Abberufung und Rückkehr in die UdSSR. Bis zu seinem Tod lehrt er als Professor in Leningrad Ökonomie. Sein Hauptwerk (zusammen mit Wiktor L. Scheinis) 'Aktuelle Probleme der Politischen Ökonomie des heutigen Kapitalismus' erscheint 1975 auch auf Deutsch.
Den sensiblen Russen haben uns die Pardons auf eine ebenso berührende wie informative Weise nähergebracht. Eine Geschichtsunterrichtung im besten Sinne, weil Tulpanows Wirken vor allem eines aufzeigt: Aus Feinden können Freunde werden. Woran wir uns gerade heute wieder erinnern sollten, meint Alfons Huckebrink.
Die Biografieempfehlung des Monats März 2025
Christine Eichel: Clara. Künstlerin, Karrierefrau, Working Mom. Clara Schumanns kämpferisches Leben. München: Siedler Verlag 2024
Diese Biografie zu Clara Schumann (1819-1896) weist einen Aufbau ähnlich einer Komposition auf, sind doch die Kapitelnamen den Sätzen einer Symphonie, einer Oper oder auch eines Entwicklungspsychologielehrbuchs entlehnt: Präludium, Verdrängtes, Drama, Zwänge, Balanceakte, Abgrenzung und schließlich Ausbruch, Lorbeeren, Vermächtnis, usw.
Gleichzeitig zeichnen die Kapitelnamen die Chronologie der inneren Entwicklung eines entfremdeten und zur narzisstischen Selbstverlängerung des ehrgeizigen Vaters missbrauchten Kindes zur sich selbst erfolgreich vermarktenden selbstständigen Künstlerin. Selbstbewusst wird sie niemals sein und ein Leben lang unter Lampenfieber leiden, dafür sind die Entwertungen ihres Vaters und später ihres Ehemannes zu wirkmächtig, und ihre Grundlage zu brüchig, fehlte es ihr doch in frühen Jahren an Liebe und Wertschätzung, vor allem an Ermutigung zum eigenen Weg.
Mit fünf Jahren muss sie ihre vom Vater geschiedene Mutter verlassen und wird dem Vater, Friederich Wieck, zugesprochen. Für eine Fünfjährige ein schmerzlicher Schritt. Für ihn muss sie vor allem funktionieren, von ihm wird sie durch unerbittliche Strenge zum "Wunderkind" erzogen.
Eichels Biografie ist das feministische Psychogramm einer emotional ausgehungerten, zum Wunderkind herangezogenen Persönlichkeit, die Schritt für Schritt aus der Not eine Tugend macht und stetig mehr Selbstbestimmung und Widerstandskraft entwickelt. Im Zentrum steht allerdings die Beziehungsfalle, als die ihre Ehe zu Robert Schumann beschrieben wird. So existiert diese nach Ansicht der Biografin über lange Zeiträume eher in der Fantasie, da es eine Fernbeziehung und, da nicht real, auch eine Beziehungsfalle ist. Diese passt zu Claras emotionalem Ausgehungertsein, einem möglicherweise (Nähe) vermeidenden Bindungsstil (Anm. GR), und ist nachvollziehbar lediglich im Hinblick auf die Verletzungen ihrer Kindheit (Ich kann mich nicht auf Beziehungen verlassen). Als sie Robert Schumann kennenlernt, ist sie 12 Jahre alt und jener der Klavierschüler ihres Vaters. Während sie schon früh Karriere als produzierende und ausführende Künstlerin und Virtuosin macht und von ihrem Vater darauf vorbereitet wird, führt ihr zukünftiger Ehemann ein ausschweifendes, auch bisexuelles Leben und steckt sich unterdessen mit Syphillis an, an deren sekundären Folgen er im Jahre 1856 verstirbt. Gegen den Willen ihres Vaters heiratet sie Robert und nimmt als junge Frau jede Untreue, jedes zweifelhafte Verhalten Roberts in Kauf, bagatellisiert oder verdrängt dieses. Brüche in der Beziehung, z.B. die geringe Zuverlässigkeit ihres Partners, werden verdrängt, weil das bisschen Liebe und Abenteuerlust, was Robert Schumann ihr als junge und vollkommen unerfahrene Frau bietet, so verführerisch wie ein Zuckerstückchen nach jahrelanger Diät erscheinen muss.
Wie sie mit dem Ehering dann schnell in die 2. Reihe und im wahrsten Sinne des Wortes in den Schatten ihres Ehemannes Robert gestellt wird, zeigt eine Episode aus dem Kapitel „Rivalitäten“ mit dem Bildhauer Ernst Rietschel, in welcher der gekränkte Ehemann auf dem Vortritt in der Skulptur besteht und Clara wie immer nachgibt. Dabei erbringt sie mit ihren Konzert - Auftritten den Hauptteil des Familieneinkommens und ist bereits eine dem Einfluss des Vaters entwachsene Komponistin. Sie muss die Entwertungen ihres Mannes nicht nur ertragen, sondern zweifelt selbst an ihren Kompetenzen. Das Komponieren gestattet ihr der Ehemann, da es sich eher mit einem zurückgezogenen häuslichen Leben vereinbaren ließ. Andererseits gestattet er ihr nur noch hochgeschlossene Kleidung und verlangt das Tragen einer Haube, selbst bei Konzerten.
Von ihrem Vater emanzipiert sie sich bereits als junge Frau, auch durch die Verbindung mit Robert, aber auch weil sie ihm fachlich überlegen ist, denn schon „früh wird der Genius flügge“. Sie hält sich bei ihren Kompositionen nicht an vorgefertigte Schemata und nutzt ihr Talent für freies Improvisieren, wozu sie einiges an Erfahrung mitbringt. Der Wille, etwas Einzigartiges zu schaffen, ist unverkennbar. In ihrem kompositorischen Dialog erfahren die Eheleute Schumann Nähe und gegenseitige Befruchtung. Sie komponiert nun aus Liebe und Hingabe zu Robert Schumann. Aus gegenseitiger Inspiration wird zunehmend eine ungleiche Beziehung, in der Clara zurücksteht und zur Unterstützerin und Muse degradiert wird. Eine Biografie CS's geht nicht ohne Berücksichtigung von RS, der eher als schwierig gilt. Als er später eine Stelle als städtischer Musikdirektor in Düsseldorf erhält, ist die Familie halbwegs abgesichert. Da er als dilettantischer Dirigent gilt, muss Clara häufig übernehmen. Und dennoch komponiert Schumann in Düsseldorf einen wichtigen Teil seines musikalischen Werks. Zu dieser Zeit stößt auch der junge und schöne Johannes Brahms zu ihnen. Er ist mit beiden Eheleuten befreundet. Von der Biografin wird die Konstellation als gelungene Dreier-Beziehung bezeichnet. Mit zunehmender psychischer Erkrankung sieht RS es zunehmend weniger gern, wenn seine Frau zu viel konzertiert, es häufen sich aggressive Ausfälle, die vermutlich einen inneren Abschied CS's ebnen und zum Ausbruch aus dem bürgerlichen Familienmodell führen. Johannes Brahms wird während des Aufenthalts in des Ehemanns zum Lebensgefährten, Tröster und Teilzeit-Babysitter. Er hängt ein Leben lang an CS, doch diese wird sich niemals mehr eine Ehe eingehen. In der letzten Phase ihres Lebens übernimmt CS die Rolle der künstlerischen Nachlassverwalterin ihres Ehemannes, da sie RS's Stücke häufig spielt - dabei spinnt sie die Legende der ewig treuen und und liebevollen Beziehung, die für den Publikumserfolg wesentlich ist. Sie versteht ihr Publikum, ist erfolgreich im Marketing und weiß ihr Publikum zu überzeugen. Eine wenig überzeugende Rolle spielt sie selbst als Mutter, ihre sieben Kinder bezahlen den Preis für den Erfolg ihrer Eltern. Sie werden auf die Verwandtschaft verteilt, wenn sie nicht funktionieren, in Erziehungsanstalten untergebracht. Was es heißt, eine fürsorgliche und liebevolle Mutter zu haben, hat CS selbst nie erfahren, wohl auch deshalb konnte sie diese Rolle selbst nicht ausfüllen und wollte es auch nicht. Ihren Weg nachzuvollziehen, ermöglicht die sehr zu empfehlende Biografie von Christine Eichel, konstatiert Gudula Ritz.
Die Biografieempfehlung des Monats Februar 2025
Gunna Wendt: Franziska zu Reventlow. Die anmutige Rebellin. Berlin: Aufbau Taschenbuch 2011
Ich bildete mir immer ein, mein Leben müßte etwas fabelhaft Großes und Reiches werden, aber es geht mir alles immer in Trümmer.
(FR an der Jahreswende 1896/87)
25 Jahre zuvor, am 18. Mai 1871, wird Franziska zu Reventlow als fünftes von sechs Kindern geboren. Zufällig sind ihre Lebensdaten, sie stirbt am 16. Juli 1918 nach einem Fahrradunfall, mit denen des wilhelminischen Kaiserreichs identisch. Die gute alte Zeit? Nichts läge ferner, als diese Epoche, die in die Katastophe des ersten Weltkriegs mündet, unter diesem Blickwinkel zu verklären. In Franziska zu Reventlows (FR) Kindheit fallen Bismarcks Kulturkampf sowie die berüchtigten Sozialistengesetze.
Ihr Vater, Ludwig Graf zu Reventlow, ist Königlich-Preußischer Landrat. Die protestantische Adelsfamilie lebt im Schloss vor Husum, ihr vertrauter Freund ist der berühmte Schriftsteller Theodor Storm. Von Beginn an schwierig gestaltet sich Franziskas Beziehung zur Mutter, Emilie Julia Anna Luise Gräfin zu Reventlow, geb. Gräfin zu Rantzau, "eine Frau auf Noth und Tod für alle, die sie liebt." So schwämt Th. Storm in einem Brief von ihr. Franziska hingegen klagt 1890 in einem Brief an ihren Jugendfreund E. Fehling über ihre rigide Erziehung: Sie kann mich nicht leiden, seit frühester Kindheit bin ich immer ein Stiefkind gewesen. [...] Sie können sich nicht denken, wie grausam schwer diese häuslichen Verhältnisse sind, wenn man sich nach Liebe sehnt und immer zurückgestoßen wird. Eine Welt, in der die Frauen bleichsüchtige,spitzklöppelnde, interessenlose Geschöpfe sind, wie sie später in ihrem autobiografischen Roman Ellen Olestjerne konstatiert. Eine Welt, der sich FR am Ostersonntag 1893, kurz vor Tagesanbruch durch ihre Flucht aus dem Pfarrhaus in Adelby, wo ihre Eltern sie unter Kuratel gestellt haben, entzieht. Der vollkommene Bruch einer radikalen Nonkonformistin, die Flucht aus ihrem feudalen Gefängnis. Fortan führt sie in der Münchner Boheme ein Leben in Freiheit und mit einem unbedingten Glücksanspruch: Ich will überhaupt lauter Unmögliches aber lieber will ich das wollen, als mich im Möglichen schön zurechtlegen. Ein ungeheurer Anspruch. Ungebundene Liebe, erotische Abenteuer, eine freie und vor allem prekäre Schriftstellerexistenz, Wohngemeinschaft, ein Kind ohne Vater. Es gibt kaum ein Tabu, das sie nicht gebrochen hat.
Jenseits aller Klischees und Zuschreibungen, die FR im Laufe der Jahrzehnte angetragen wurden, erzählt Gunna Wendt das Leben der "anmutigen Rebellin" (Erich Mühsam) als kompromisslose Suche nach Freiheit und Glück und greift damit einen Vorschlag R.M. Rilkes auf, der bereits 1904 darauf hinweist, dass ihr Leben eins von denen ist, die erzählt werden müssen.
In beeindruckender Manier gelingt dies der Autorin mit ihrer schön illustrierten Biografie, der sie sehr passend ein Zitat der erst vor wenigen Tagen gestorbenen Marianne Faithful voranstellt: "I drink and I take drugs / I love sex and I move around a lot." Zwei Schwestern, nicht nur im Geist der Rebellion, auch in Anmut, meint Alfons Huckebrink
Die Biografieempfehlung des Monats Januar 2025
Claire A. Nivola: Das blaue Herz des Planeten. Die Geschichte einer Meeresforscherin: Sylvia Earle. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 2021
Diese ausdrucks- und eindrucksvoll bebilderte Biografie für Menschen ab einem Alter von etwa 10 Jahren stellt in vielfacher Hinsicht etwas Besonderes dar.
Das Erste, was augenfällig wird, ist ihre ungewöhnliche Form als biografischer Text, untermalt wie eingebettet in wunderschöne und doch biologisch korrekte Bilder. Die Biografie nimmt ihren
Ausgangspunkt an der Bedeutung des Meeres für den Planeten Erde und die Entstehung und Aufrechterhaltung des Lebens, auch des menschlichen Lebens. Dabei werden zentrale biografische Aussagen der
weltberühmten Ozeanografin Sylvia Earle (SE) zitiert, die 1935 in New Jersey geboren wurde und insgesamt mehr als 7000 Stunden unter Wasser verbracht hat.
Als sie 3 Jahre alt ist, ziehen ihre Eltern auf einen alten Bauernhof, damit die 3 Kinder inmitten der Natur aufwachsen können. SE schöpft aus dieser Umgebung und nutzt die Gegebenheiten in vollen Zügen; sobald sie malen und schreiben kann, dokumentiert sie, alles, was sie sieht, und bezeichnet sich später selbst als Biologin und Naturforscherin von klein auf. Mit 12 Jahren zieht ihre Familie nach Florida um, und im Golf von Mexiko verliert sie ihr Herz an die Wasserwelt. Schon früh erhält sie Tauchausrüstungen und studiert folgerichtig Meeresbiologie und Ozeanografie. Später schließt sie sich als einzige Frau einer 70 Personen starken Expedition in den Indischen Ozean an.
Die Biografin erzählt von zahllosen Tauchgängen, besonderen Begebenheiten und Abenteuern wie Begegnungen mit Meerestieren, z.B. Buckelwalen oder Leuchttierchen
oder
Leuchtalgen. Sylvia habe eine Milchstraße unter Wasser vorgefunden.
Diese Biografie wäre auch als besonderes Weihnachtsgeschenk für Kinder wie Erwachsene geeignet gewesen. Nun, das nächste Weihnachten und der nächste Geburtstag kommen bestimmt.
Eine Meisterleistung der Autorin und Malerin Claire A. Vivola, mit so wenigen Worten und prägnanten Bildern das Leben und bedeutsame Aussagen über das Schaffen dieser Meeresbiologin, über die Schönheit und Bedeutung der Ozeane zu vermitteln, findet Gudula Ritz, die in ihrer Jugend den Beruf der Ozeanografin ernsthaft für sich selbst erwogen hatte.